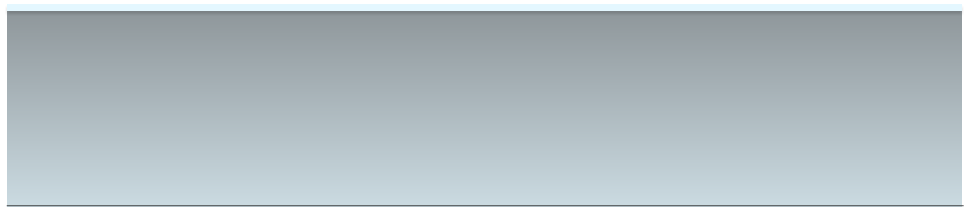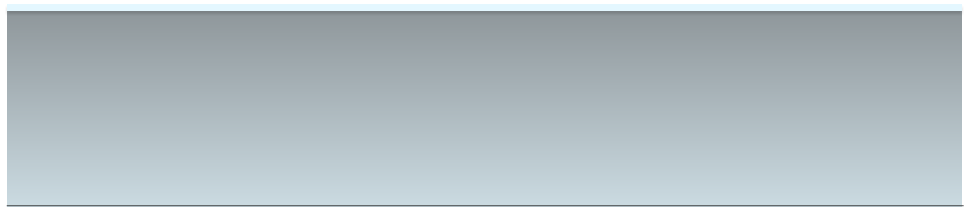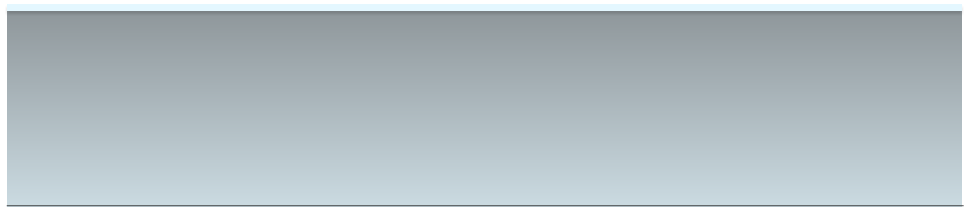
IT-Verträge

© Gruber&Gruber Beratung e.U.


Kauf von Hardware und Standardsoftware
In der Praxis birgt die Vertragsgestaltung im Zusammenhang mit dem Erwerb von
Hardware und Standardsoftware meist keine wesentlichen Probleme, soweit sich
Verkäufer und Käufer darüber einig sind, dass mit dem Erwerb auch tatsächlich
Eigentum durch den Käufer erworben werden soll. Inwieweit an Software – als
unkörperliche Sache – tatsächlich Eigentum erworben werden kann, ist nicht
unumstritten. Häufig wird ist durch den Anbieter von Software gar keine
Übertragung des Eigentums beabsichtigt, sondern vielmehr die Einräumung von
eingeschränkten Nutzungsrechten (siehe Lizenzverträge). Zudem ergeben sich in
der Praxis vielfach Probleme mit der Durchsetzung von
Gewährleistungsansprüchen. Daher gilt es schon bei der Formulierung des
jeweiligen Vertrages auf diese Problemfälle spezifisch einzugehen und die
individuellen Erfordernisse des jeweiligen Falles mit zu berücksichtigen.
Erstellung von Individualsoftware
Im Zusammenhang mit einem Auftrag zur Erstellung von Individualsoftware ist
grundsätzlich zu unterscheiden, ob die Erstellung durch Mitarbeiter eines
Unternehmens im Rahmen eines Dienstverhältnisses erstellt wird, oder ob die
Erstellung der Software durch Unternehmensfremde erbracht wird. Im Ersten Fall
handelt es sich in der Regel um Leistungen aus einem Dienstvertrag, wobei durch
den Dienstnehmer nicht das spezifische „Ergebnis“ sondern vielmehr redliches
Bemühen und Arbeitszeit geschuldet wird. Im zweiten Fall kann es sich in jenen
Fällen, in denen ein spezifisches Ergebnis geschuldet wird um einen Werkvertrag,
in Fällen, in denen primär „Programmierdienstleistung“ geschuldet wird auch um
einen Dienstleistungsvertrag handeln. Grundsätzliche Problembereiche in
Zusammenhang mit Individualsoftware (und auch der Anpassung von
Standardsoftware durch Dritte) finden sich häufig Zusammenhang mit
Gewährleistungsthemen, wenn das Ergebnis nicht den Vorstellungen des
Auftraggebers entspricht. Soweit hier durch den jeweiligen Vertrag die
geforderten Leistungen (durch Pflichten- bzw. Lastenheft), sowie allfällige Kriterien
der Abnahme (Mängelkategorien, Abnahmefristen, Testszenarien, etc.) definiert
sind, kann im Anlassfall auf die vertragliche Regelung Bezug genommen werden.
Soweit erforderlich kann in diesen Verträgen auch geregelt werden, welche
Rechte in Bezug auf Nutzung und Verwertung des Produktes auf den
Auftraggeber übergehen, bzw. ob dieser auch Anspruch auf Übergabe des
Source-Codes hat.
Wartungsverträge
Vielfach werden im Zusammenhang mit der Nutzung von Standard- und
Individualsoftware auch sogenannte Wartungsverträge angeboten, durch die
dem Nutzer über das allgemeines Nutzungsrecht auch Anspruch auf die jeweils
aktuelle Version der Software und das Recht auf Inanspruchnahme von
Unterstützung (Support) einräumen. Da die Kosten für diese (vielfach
verpflichtenden) Wartungsdienstleistungen einen nicht zu vernachlässigenden
Prozentsatz der Anschaffungskosten betragen, ist auch diesen Verträgen
entsprechendes Augenmerk zu widmen. Insbesondere gilt es hier den konkreten
Leistungsumfang dieser Verträge zu prüfen und dem tatsächlichen Bedarf
gegenüber zu stellen. Häufig mangelt es diesen Verträgen einer klaren
Abgrenzung zwischen „Wartung“ (neue, verbesserte Leistungen) einerseits und
Gewährleistung (Beseitigung von Mängeln) andererseits.
Lizenzverträge (EULAs)
In geht mit dem Erwerb von Standardsoftware der Abschluss eines Lizenzvertrages
einher. Diese Lizenzverträge (manchmal auch End-User-Licence-Agreement EULA
genannt) beinhalten allgemeine Vertragsbedingungen zur Verwendung der
jeweiligen Software, insbesondere die Einräumung von meist eingeschränkten
Nutzungsrechten, Bestimmungen über Gewährleistung und Haftung, sowie
Bestimmungen über die Auflösung des jeweiligen Vertrages. Meist beinhalten
diese Verträge Bestimmungen, die den Lizenzgeber eher begünstigen und den
Lizenznehmer einschränken. Vermehrt werden Standardsoftware-Produkte nicht
mehr auf Datenträger angeboten, sondern vielmehr über das Internet zum
Download. Der Lizenzvertrag selbst wird dabei meist im Zuge des Installations-
Vorganges erstmalig angezeigt und muss vom Anwender akzeptiert werden,
wodurch ein in der Regel gültiger Vertrag geschlossen wird. Ein Ablehnen des
Lizenzvertrages führt meist zu einem Abbruch des Installationsvorganges und wirft
das allfällige Problem einer Rückabwicklung des Vertrages über den Software-
Erwerb auf. In der Praxis sind auf Lizenzverträge die Bestimmungen für allgemeine
Geschäftsbedingungen anzuwenden, diese sind einer Einbeziehungs-, Geltungs-
und Inhaltskontrolle zu unterziehen. Soweit mit der Nutzung von Software ein
zwingender Abschluss eines derartigen Vertrages verbunden ist, empfiehlt es sich,
sich rechtzeitig Kenntnis vom jeweiligen Vertragsinhalt zu verschaffen und
allenfalls –soweit wesentliche Punkte nicht auf dem Verhandlungsweg zu klären
sind – von einem Vertragsschluss Abstand zu nehmen.
Service Level Agreements (SLAs)
sind Vereinbarungen über Inhalt, Umfang und Qualität von Dienstleistungen. SLAs
kommen vor allem im Zusammenhang mit Wartungsverträgen für Hard- und
Software als auch in Outsourcing-Verträgen zur Anwendung, bei denen nicht nur
Dienstleistungen erbracht, sondern komplexe Aufgabenbereiche
eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu erbringen sind.
Ziel derartiger Verträge ist es, für beide Seiten Rechte und Pflichten auf
vertraglicher Basis zu vereinbaren. Zudem sind diese SLAs Grundlage für die
Verrechnung von Leistungen.